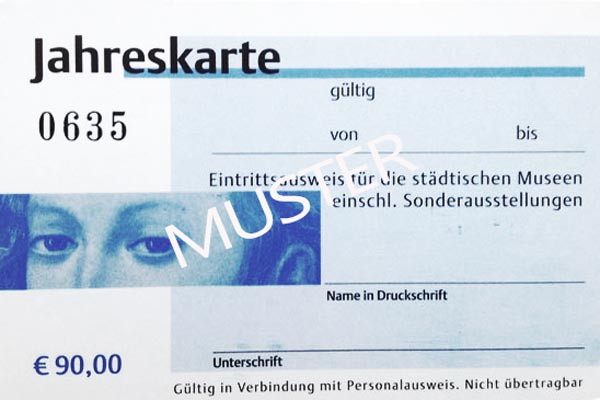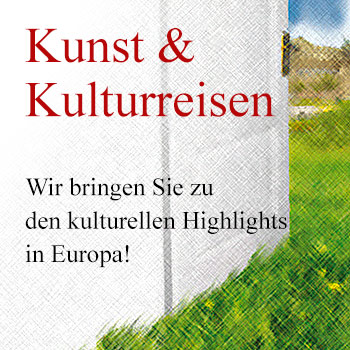Staatenhaus am Rheinpark, Saal 1
Die tote Stadt

- Die tote Stadt | Staatenhaus
Foto: Paul Leclaire

Die tote Stadt | Staatenhaus
Foto: Paul Leclaire
Oper - Erich Wolfgang Korngold
Oper in drei Bildern
frei nach Georges Rodenbachs Roman »Bruges-la-morte« (»Das tote BrÌgge«)
Musik von Erich Wolfgang Korngold (1897 â?? 1957)
in deutscher Sprache mit deutschen Ă?bertiteln
MUSIKALISCHE LEITUNG Gabriel Feltz
INSZENIERUNG Tatjana GĂŚrbaca
BĂ?HNE Stefan Heyne
KOSTĂ?ME Silke Willrett
LICHT Andreas GrĂŚter
CHOR Rustam Samedov
DRAMATURGIE Georg Kehren
Korngold, der schon als DreizehnjĂ€hriger die UrauffĂŚhrung seiner Pantomime "Der Schneewind" an der Wiener Hofoper erlebte, galt in seiner Heimatstadt als Wunderkind. Gemeinsam mit seinem Vater, einem in Wien tĂ€tigen bekannten und gefĂŚrchteten Kritiker, verfasste er junge Korngold das Libretto zu seiner bekanntesten Oper "Die tote Stadt" nach dem Drama "Le Mirage", zu dem Georges Rodenbach 1897 seinen fĂŚnf Jahre zuvor erschienenen Roman "Bruges-la-Morte" umgearbeitet hatte. 1920 wurde die Oper gleichzeitig in Köln (unter Otto Klemperer) und in Hamburg uraufgefĂŚhrt. Sie fand rasch Verbreitung im In- und Ausland, teilweise mit Spitzenbesetzungen, und bis 1933 wurde sie an mehr als siebzig BĂŚhnen aufgefĂŚhrt. Mit der MachtĂŚbernahme der Nationalsozialisten in Deutschland und dem Austrofaschismus fand die Karriere des jĂŚdischstĂ€mmigen Komponisten im deutschsprachigen Raum ihr jĂ€hes Ende. In Hollywood fand Korngold Exil und ein neues BetĂ€tigungsfeld. Schon 1934 hatte er fĂŚr Max Reinhards Verfilmung des "Sommernachtstraums" eine Filmmusik komponiert, die freilich noch stark von Mendelssohns gleichnamiger Schauspielmusik inspiriert war. Doch spĂ€ter avancierte er mit seiner eigenen spĂ€tromantischen Klangsprache zu einem der erfolgreichsten Filmkomponisten Hollywoods. Dieser Erfolg hatte freilich seinen Preis: Er beschĂ€digte sein Renommee als seriöser Komponist und erschwerte ihm die RĂŚckkehr in das europĂ€ische Musikleben nach dem Ende des Krieges. â??Korngold, dessen Hauptwerke wie in einer rituellen Beschwörung des Nicht-Vergessen-Werdens um die Auferstehung kreisen, gehörte wie Zemlinsky, Schreker und andere zu jenen Komponisten, denen zwei Mal das Lebensrecht bestritten wurde: durch die faschistische Verfemung 1933 und durch das musikalische Fortschrittsdenken nach 1945.â?? (Schreiber) Selbst den Wiederaufnahmen seiner seinerzeit erfolgreichsten Oper waren nach dem Zweiten Weltkrieg allenfalls Achtungserfolge ohne Nachwirkung beschieden. 1967 wurde "DieTote Stadt" zu postumen Feier von Korngolds 70. Geburtstag wieder gegeben, allerdings nicht einmal mehr in der Staatsoper, sondern â??nurâ?? noch in der Volksoper.
â??Roman und Drama Rodenbachs bewegen sich in der dekadent symbolistischen, stark von Edgar Allen Poe beeinflussten Vorstellungswelt des Fin de siĂšcle.â?? (Schreiber) In der durch die Versandung des Hafens von der Umwelt abgeschlossene und dahinsiechende flandrische Stadt BrĂŚgge lösen sich alle festen RealitĂ€ts- und Persönlichkeitsstrukturen auf. Das gotische Ambiente der Stadt mit ihren Kirchen und Klöstern, mit Belfried und Beginenhof, mit ihren Gassen und KanĂ€len wird auf mannigfache Weise mit dem Schicksal der handelnden Personen verknĂŚpft, so jedenfalls der Roman. In Korngolds Libretto hingegen ist diese wechselseitige Spiegelung von Ambiente und Figuren aufgelöst und aufgeteilt. Zu Beginn und am Ende erleben wir eine realistische SphĂ€re.
Die eigentliche Handlung nach dem Besuch Mariettas bei Paul erleben wir hingegen als getrĂ€umte Vision Pauls: Seine jung verstorbene Frau Marie tritt aus ihrem eigenen PortrĂ€t heraus und erinnert ihn mit Mariettas Stimme an das ihr einstmals gegebene eheliche Treueversprechen. Paul wird als Beobachter Zeuge, wie Marietta mit ihrer Komödiantentruppe die Auferstehungsszene einer Nonne aus Meyerbeers Oper "Robert le Diable" probt. In einer an seinem Hause vorĂŚberziehenden Prozession meint er seine tote Frau wiederzuerkennen und erwĂŚrgt Marietta schlieĂ?lich. Danach erwacht Paul aus seinem Traum und sieht sich â?? fĂŚr den Zuschauer ĂŚberraschenderweise - von allen nekrophilen Neigungen befreit. Denn als die HaushĂ€lterin Mariettas RĂŚckkehr meldet, die in der ersten Szene Regenschirm und Rosen bei ihrem Besuch liegen gelassen hatte, erklĂ€rt Paul seinem Freund Frank, das morbide BrĂŚgge nunmehr endgĂŚltig verlassen zu wollen.
Die Korngolds eigenem Libretto geschuldete platte Zweiteilung in RealitĂ€t und Vision, die der Rodenbachschen Vorlage mit ihrer subtilen VerknĂŚpfung von Figuren und Ambiente, von RealitĂ€t und Vision nicht gerecht wird, hat bei der Rezeption der Oper immer wieder zu Regieexperimenten gefĂŚhrt, um die SphĂ€ren der Handlung vorlagengerecht miteinander zu verschrĂ€nken. Dieser Spur folgt auch Tatjana GĂŚrbaca, die die Oper in Köln neu inszeniert hat: â??RealitĂ€t und Vision sind fĂŚr Paul nicht mehr zu trennen. Fehlgeleitete Projektion und Wunschdenken bedingen Eifersucht und Hass. SchlieĂ?lich steigert sich die emotional aufgereizte Auseinandersetzung zwischen Paul und der TĂ€nzerin [Marietta, dem Ebenbild seiner verstorbenen Frau Marie,] bis ins mörderische Extrem. Am Ende â?? so die lĂ€uternde, an psychoanalytische Erkenntnisse der Entstehungszeit angelehnte Auflösung des Geschehens â?? steht jedoch nicht der Tod, sondern das Bekenntnis zum Leben.â?? (Oper Köln)
â??Auch musikalisch ist es Korngold mit dem oft ĂŚberdimensioniert klingenden Orchester trotz des Einsatzes von Celesta, Klavier und Harmonium sowie heftigem Glockengetöne in bestimmter und unbestimmter Tonhöhe kaum gelungen, dem phantasmagorischen Ambiente der toten Stadt BrĂŚgge eigenen Klang zu geben. Die eingeschobenen Prozessionen â?? zu der [ ... ] mit der mittelalterlichen Hymne "Pange Lingua" im 3. Akt kommt noch ein Aufzug von Beginen auf dem Weg ins Kloster als Kontrast zur FrivolitĂ€t der Theatertruppe um Marietta im 2. â?? helfen diesem Mangel mehr optisch als akustisch ab. Andrerseits sind die musikalischen QualitĂ€ten der Partitur offenkundig, besonders in dem trotz der hohen Tessitura [dem Bereich des Stimmumfanges, der fĂŚr den musikalischen Ausdruck nutzbar ist] fĂŚr die beiden Protagonisten dankbaren Vokalstil. Mariettas im 1. Akt von Paul aufgegriffenes Strophenlied zur Laute "GlĂŚck, das mir verblieb "[ ... ] ist ein Ohrwurm geworden [ ... ]. Kaum minder gesanglich sind das Arioso von Pauls HaushĂ€lterin Brigitta "Was das Leben ist, weiĂ? ich nicht", eine warm orchestrierte lichte E-Dur-Melodie, und das Pierrot-Lied des mit Wagners Rheinmotiv als RheinlĂ€nder apostrophierten Fritz "Mein Sehnen, mein WĂ€hnen", in dessen sentimentale Bewegung eines langsamen Walzers einmal ein achtstimmiger Frauenchor tönt.â?? (Schreiber)
Dr. Hans-Gerhard Neugebauer
DruckenSpielstätteninfo

 So funktioniert´s
Ihre Vorteile
Eine tolle Geschenkidee!
Mitglieder werben Mitglieder
Häufige Fragen
Teilnahmebedingungen
So funktioniert´s
Ihre Vorteile
Eine tolle Geschenkidee!
Mitglieder werben Mitglieder
Häufige Fragen
Teilnahmebedingungen
 Instagram
Instagram